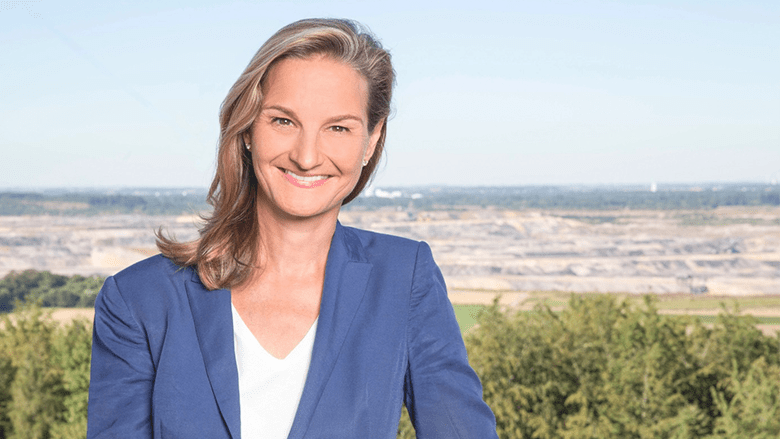
Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst möchte ich die Absicht hinter dem Reparaturbonus würdigen. Der Wunsch, Elektroschrott zu reduzieren und die Lebensdauer von Geräten zu verlängern, ist zweifellos wichtig und ein „Beitrag gegen die Wegwerfgesellschaft“. Doch die Erfahrungen anderer Länder zeigen, dass ein Reparaturbonus auch Herausforderungen birgt, die gegen seine Einführung in NRW sprechen.
In der Wiener Studie „Nachhaltiges Wirtschaften – Reparaturinitiativen in Europa“ (Oktober 2024) wird dargelegt, dass Länder wie Frankreich und Österreich durch Reparaturboni hohe Verwaltungs- und Implementierungskosten hatten. Um den Bonus umzusetzen, mussten komplexe Strukturen geschaffen werden, um Anträge zu bearbeiten und die Einhaltung der Förderkriterien zu überwachen. Dies reduziert die erhofften finanziellen Vorteile für Umwelt und Verbraucher erheblich.
Die Studie zeigt außerdem, dass die Umweltwirkung begrenzt bleibt. Trotz Förderungen werden weiterhin viele Geräte entsorgt, wenn die Reparaturkosten den Bonus übersteigen. Oft sind neue, energieeffizientere Geräte ökologisch vorteilhafter als ältere Modelle, die nur durch den Bonus konkurrenzfähig sind. Ein Reparaturbonus könnte so unbeabsichtigt langfristige Nachhaltigkeitsziele konterkarieren.
Es besteht auch die Gefahr einer Marktverzerrung. Große Ketten nutzten in Frankreich den Bonus effizienter, was kleinere Werkstätten benachteiligt. Auf lange Sicht könnte dies das Überleben kleiner Betriebe gefährden und die Angebotsvielfalt verringern. Das Risiko ist, dass große Player das Programm dominieren und lokale Anbieter verdrängen.
Zusätzlich besteht das Problem der geplanten Obsoleszenz. Ein Reparaturbonus könnte den Kauf von Geräten fördern, die bald wieder reparaturbedürftig sind. Ohne ausreichende Kontrollen ist das Programm anfällig für Missbrauch, wie etwa manipulierte Reparaturanforderungen. Erfahrungen in England und Österreich zeigten dies deutlich.
Die Förderungen decken zudem oft nur bestimmte Gerätekategorien ab, was die Wirkung des Programms einschränkt. Viele Geräte sind vom Bonus ausgeschlossen, was zu Enttäuschungen führen kann. Dieser Ansatz geht zudem nicht auf andere von der Wegwerfgesellschaft betroffene Bereiche ein, wie etwa Kleidung und Schuhe, die auch dringend nachhaltige Lösungen benötigen.
Ihr Antrag greift in den Markt ein und bleibt daher zu kurz gegriffen. Um eine nachhaltige „Reparaturkultur“ zu fördern, sehe ich alternative Ansätze als effektiver an.
Diese haben sich bereits bewährt und stehen im Einklang mit der neusten EU-Richtlinie zum „Recht auf Reparatur“. Diese Richtlinie fordert Hersteller auf, auch nach Ablauf der Gewährleistung Reparaturen zu fairen Preisen anzubieten.
Ich möchte drei markterprobte Ansätze vorstellen, die den notwendigen Wandel zur Reparaturkultur unterstützen und langfristig tragfähig sind.
1. Steuerliche Anreize: Schweden hat eine Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Reparaturen um 50 % eingeführt. Das Modell zeigt, wie steuerliche Anreize für kleine und mittlere Unternehmen die Kreislaufwirtschaft stärken. So kann der Verwaltungsaufwand minimiert und der Landeshaushalt nicht belastet werden, während günstige Produkte und Arbeitsplätze gefördert werden.
2. Akzeptanz und Aufklärung: Reparaturen müssen attraktiver werden. Second-Hand ist aktuell immer noch beliebter als Reparatur. In Frankreich zeigt ein „Reparierbarkeitsindex“ auf dem Produkt, wie sich Reparaturen lohnen.
Ein solcher Index schafft Transparenz und stärkt das Vertrauen der Verbraucher.
Der Weg zur 3 R Gesellschaft - Repair - Reuse - recycle beginnt mit viel Aufklärung und dem Aufbau eines positiven Images für Reparaturen.
3. Marktwirtschaftliche Ansätze unterstützen: Unsere Familienunternehmer in NRW zeigen, wie zb innovative Leasingmodelle, Treue-Rabatte für Wartung und Reparatur und Sharing Modelle auch für Haushaltsgeräte - nicht nur neue Kundenbindungsqualität schaffen
sondern auch die Gewohnheiten ändern von einer Wegwerf- hin zu einer Kreislaufgesellschaft - alles ohne Subventionen, und vor allem ohne weitere Bürokratie für die Wirtschaft!
Zusammengefasst: Ein Reparaturbonus könnte kurzfristig wirken, doch die Erfahrungen zeigen, dass steuerliche Anreize, gesellschaftliche Akzeptanz und marktwirtschaftliche Mechanismen weitaus nachhaltiger sind.
Diese Ansätze fördern das Handwerk, entlasten Familien und bieten eine langfristige Perspektive für eine zukunftsfähigere Kreislaufwirtschaft in NRW.
Der Überweisung stimmen wir zu und ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss.
Vielen Dank

Empfehlen Sie uns!